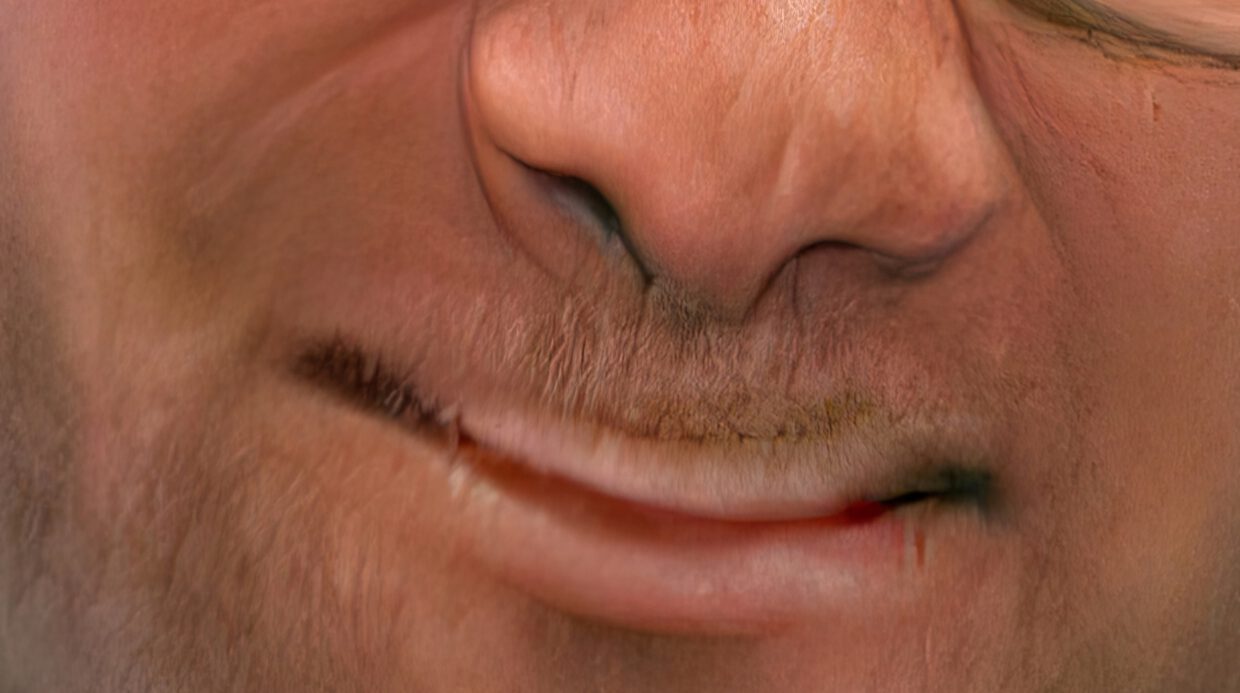Von Regina Schleheck.
Ich bin gar nicht so. Man kann das nicht oft genug sagen. Es glaubt ja doch keiner. Ich weiß nicht recht, wann das angefangen hat. In Wirklichkeit ist doch alles längst da, bevor es passiert. Man muss sich das vorstellen wie die Sache mit dem Gehirn. Eine graue brodelnde Masse, in der permanent Synapsen und Netzwerke gebildet werden. Ich denke immer, es ist wie Blaubeermarmelade einkochen. Es blubbert, bewegt sich, quillt auf, um am Ende eine mehr oder weniger konsistente Masse zu bilden, die aber, um im Bild zu bleiben, ihre Streichfähigkeit nie verliert. Die auch neue Verbindungen eingehen kann. Blaubeerjoghurt, hmmmm! So fließt eins ins andere, fügt ihm vielleicht nur eine Nuance hinzu – oder wird sogar zum Fundament für etwas ganz Neues. Ich meine, wie kommt das, dass kleine Kinder mit zwei Jahren auf einmal anfangen zu sprechen? Da müssen monatelang erst einmal Konzepte gebildet werden! In der Zeit tut das Kind, als wäre es blöd. Blubbert vor sich hin, lallt, lässt die Zunge rollen und mixt, Laute, die zu Silben aufquellen, und während die da draußen sich über den Kinderwagen beugen und jedes „Blablabla“ bejuchzen wie Goebbels Sportpalastrede, hat das Kind längst kapiert, wie es seine Follower konditionieren kann.
Das war bei mir nicht anders. So wie die Eltern im Tagebuch festhalten: „Heute zum ersten Mal Kaka gesagt“, gab es natürlich ein erstes Mal auch bei mir. Aber mein innerer Gutmensch musste genauso reifen, wie das Konzept „Kaka“ seine Zeit braucht. Man hat es im Bauch, klar, aber das alleine genügt ja nicht. Nicht das Grummeln, Drücken, der zunehmende Drang bis hin zur Entleerung machen es aus. Dazu gehören flankierende Dinge wie Blähungen, Bauchmassagen, Begeisterungsrufe, bestimmte Begriffe sowie Gerüche, das warme, weiche Gefühl am Allerwertesten, die Säuberungsprozedur und und und. Ein hochkomplexer Prozess – und dabei für jedes andere Lebewesen doch eine derartige Selbstverständlichkeit, dass es nicht im Traum auf die Idee käme, so ein Geschiss darum zu machen. Zumal der moralische Ballast! Wer außer den Menschen würde jemals auf die Idee kommen, den Exkrementen seiner Nachgeborenen Lob zu zollen? Man muss sich doch nicht wundern, dass kleinen Kindern schon ganz früh die Überzeugung eingeimpft wird, dass man sie umso lieber hat, je mehr Scheiße sie produzieren.
Mein erster Haufen – um bei dem Bild zu bleiben, es geht schließlich um moralische, nicht digestive Konzepte – ist ausführlich dokumentiert und in die Annalen der Geschichte eingegangen. Zumindest der Familiengeschichte. Deswegen so ausführlich dokumentiert, weil es sich um ein Familienfest, um die Taufe meines kleinen Bruders handelte. Genau genommen zweier meiner kleinen Brüder. Es gibt so viele davon, dass ich erst gar nicht anfangen will, hier Namen aufzuzählen. Das würde nur verwirren. Die Fülle meiner Mitbrüder sprach nicht nur für das Liebesleben in meinem Elternhaus. Sie erklärte auch den monetären Mangel, der sich unter anderem darin zeigte, dass Taufen nur im Doppelpack, später im Dreiergebinde vorgenommen wurden.
Was wiederum dazu führte, dass ein Teil der Täuflinge dem Säuglingsalter längst erwachsen war. Tauffeiern waren lebhafte Veranstaltungen, Kinderreichtum damals eine weit verbreitete Unsitte. Eine gewichtige Größenordnung an Cousins und Cousinen kam also erschwerend hinzu. Hinter dem Haus wurde getafelt, später gesoffen, während die Kinder herumtobten, wetteiferten, kletterten, sich schlugen und wieder vertrugen.
Onkel Gustav, der einzige unter meinen Onkeln, der weder über eine Frau noch über Kinder, stattdessen über eine Kamera verfügte, hatte eben begonnen, das Nachlaufspiel seiner Neffen auf Zelluloid zu bannen, als ich hinter dem Haus meinen kleinen Bruder in der Regentonne bei seinen ersten Schwimmübungen beobachtete, aus Leibeskräften um Hilfe schrie, hinter das Gebäude rannte, mir einen Stuhl schnappte, zurückraste, den Stuhl an die Tonne und mich darauf stellte, um den wild um sich schlagenden frisch Getauften zu packen und aus seiner lebensbedrohlichen Lage zu befreien.
Die Bilder des Onkels waren reichlich verwackelt. Aber auch auf wackeligen Fundamenten können beeindruckende Gebäude errichtet werden. Die erste Marke war gesetzt.
Gestochen scharf waren hingegen die Bilder, die ein Jahr darauf, nachdem ich die Kamera nur kurz aus meines Onkels Zimmer entwendet hatte, in meinen Besitz gelangten und ihn und meine Mutter bei wackeligen Leibesübungen zeigten, was mich die Schar meiner Brüder mit neuen Augen sehen ließ. Mein Onkel entschloss sich daraufhin meine fotokünstlerische Karriere zu fördern, indem er mir ein sündhaft teures Nikon-Modell übereignete, sobald ich in einem Vier-Augen-Happening meinen Filmstreifen wie weiland James Marshall Hendrix im Londoner Astoria seine Gitarre in Flammen hatte aufgehen lassen. Mit meinem feurigen Einsatz hatte ich – dessen darf ich mich, der ich meinen Vater kenne, mit Fug und Recht rühmen – die Ehe meiner Eltern gerettet. Eine Guttat, die leider in den Familien-Annalen keinen Einzug fand, allenfalls als Fußnote für Eingeweihte.
Ich wurde dennoch nicht Fotograf, sondern verfolgte den eingeschlagenen Pfad des Helfers aus brenzligen Situationen und ging bereits in jungen Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr. Der Weg in die Öffentlichkeit war beschritten.
Wie liebte ich den Alarm, die Adrenalinausschüttungen, das Tempo die Teamarbeit, die Präzision und Professionalität meiner Kollegen! Wie viele großartige Gelegenheiten, Gutes zu tun, zu retten, oft aus höchster Not! Wir haben aus brennenden Häusern von Flammen eingeschlossene Menschen geholt, die längst mit dem Leben abgeschlossen hatten. Ihre Dankbarkeit kannte keine Grenzen. Wie oft gab es nach diesen Einsätzen Bilder von unserer tapferen Truppe – mit mir in der ersten Reihe!
Ich bin sicher: Die Anlagen zu einem guten Menschen schlummern in jedem von uns. Aber man muss daran arbeiten.
Ich ließ mich in Abendkursen zum Streitschlichter, dann zum Mediator ausbilden und errang das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Als ich meine Schulzeit beendet hatte, absolvierte ich eine Ausbildung zum Rettungsassistenten. Meiner Karriere als Gutmensch stand nichts mehr im Weg.
Außer meinem Kollegen Dieter Starker. Mit seiner Langsamkeit und Begriffsstutzigkeit hielt er dauernd den Verkehr auf. Wo ich alles tat, damit wir die ersten am Unfallort sein konnten, schien sein Bemühen eher darauf ausgerichtet, so anzukommen, dass es zu spät war. Altersbedingt nachlassende Leistungsbereitschaft? Oder war er von vornherein falsch gepolt? Ein merkwürdiger Mensch! Am befremdlichsten wirkten seine Augen auf mich. Sie waren von so einem dunklen Braun, dass es mit dem Schwarz der Pupille fast verschmolz. Gelegentlich spürte ich seinen Blick auf mir ruhen. Er hatte etwas Stechendes. Was mir Kopfschmerzen bereitete. Als wenn er meine Gedanken sezieren könnte. Zumindest schien er mich genauso misstrauisch zu beäugen wie ich ihn.
Im Lebensretter-Gewerbe entscheiden oft Nanosekunden. Dieter Starker saß stets am Steuer, wenn wir zu einem Notfall raus mussten. Als ich mich bei unserem Chef beschwerte, nahm der ihn in Schutz. „Lieber Herr Kant“, sagte er. „Was nützt ein Rettungseinsatz, der nicht ankommt? Wenn ich einen Heißsporn wie Sie an Steuer ließe, müssten wir anschließend ein paar Einsätze mehr fahren!“
Das mangelnde Vertrauen meines Vorgesetzten in meine Fahrkünste nagte an mir. Ich behielt Dieter scharf im Auge und mein Misstrauen erhielt neue Nahrung, als ich begann akribisch festzuhalten, wie oft er sich Fehler leistete, sich verfuhr, Geräte vergaß, verwechselte oder falsch anschloss, kurz, das Leben unserer Notfallpatienten fahrlässig aufs Spiel setzte.
Wirklich fahrlässig?
Dieter war immer der letzte, der nach unseren Einsätzen die Umkleide aufsuchte, um zu duschen. Wir Jüngeren respektierten diese Marotte, hielten ihn für prüde oder alterseitel. Eines Tages hatte ich aber meinen Schlüssel in meinem Spind vergessen, kehrte auf dem Nachhauseweg um, betrat das Gebäude, in dem kein Licht mehr brannte, überraschte Dieter in der Umkleide und wurde Zeuge, wie mein vermeintlicher Kollege sich als monströse Missgeburt entpuppte: Er hatte seine Dienstkleidung abgelegt und war im Begriff sich aus einem Latexganzkörperkondom zu schälen. Zunächst legte er einen Kopf frei, der von riesigen Augen dominiert wurde, hervorquellenden schwarzen Insektenaugen. Dann kam ein langer behaarter Arm zum Vorschein, ein zweiter folgte, es wurden immer mehr, drei, vier, sechs, acht dünne Beine von abgrundtiefer Hässlichkeit. Ein Oktopode? Der haarige Besatz sprach eine andere Sprache. Ich hatte es mit einem Spinnenmenschen zu tun!
Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Spiderman! Deutlich gealtert, aber unverkennbar. Offensichtlich hatte er gehofft, die letzten Jahre bis zur Rente undercover in unserer Einsatzzentrale verbringen zu können. Was für ein Mimikry! Der Berufsböse als Lebensretter! Kein Wunder, dass er es dauernd vergeigt hatte! Dem Monster musste es ja einem Konzept für das Gute mangeln! Ich schnaubte.
Er fuhr herum, kapierte, dass er entdeckt war, kreischte „Mark!“ und langte mit seinen Tentakeln nach mir.
Ein erbitterter Kampf um Leben und Tod begann. Ja, das war eine andere Nummer als meine Feuerwehr- oder Lebensrettereinsätze. Es ging ans Eingemachte. Und: Hier stand Mensch gegen Monster. Gut gegen Böse!
Während er Fäden von klebriger Konsistenz absonderte, in die er mich einzuwickeln trachtete, gelang es mir, den Feuerlöscher zu schnappen. Ich zielte direkt auf seine grässliche Visage und ließ es schäumen. Der Strahl verfehlte seine Wirkung nicht. Der vermeintliche Dieter Starker kreischte, versuchte das Löschmittel aus den Augen zu wischen und rieb es damit nur tiefer hinein. Er fuchtelte mit Armen und Beinen oder wie auch immer man diese Auswüchse nennen sollte, zuckte und erschlaffte schließlich. Ich konnte ihn mittels seiner eigenen Tentakel fesseln.
Keuchend und sich windend lag er vor mir. War aber noch lange nicht am Ende. Er spuckte Gift und Galle, beschimpfte mich, kreischte, ich hätte kein Recht mich als der Gute aufzuspielen, ich sei keinen Deut besser als er. Und dann warf mir alle meine Sünden an den Kopf. Dabei zeigte er sich erstaunlich gut informiert. Über Dinge, die ich selbst längst in meine hintersten Hirnkammern verbannt hatte. Woher wusste er das alles?
Der stechende Blick! Er schien tatsächlich in der Lage zu sein, Gedanken zu lesen! Selbst von dem Schubs, mit dem ich meinen kleinen Bruder in die Tonne befördert hatte, und den Filmstreifen, die ich zu Anschauungszwecken behalten hatte, meinem Onkel vortäuschend, ich hätte nicht mehr als ein paar Schnappschüsse gemacht, wusste er. Jeden einzelnen Brandherd, den ich gelegt – ach, und vieles mehr. All mein Bemühen um moralische Unanfechtbarkeit war von Anbeginn an von Schmutz getrübt gewesen, von bösen Begleiterscheinungen, samt und sonders dem Wunsch geschuldet, das Gute umso strahlender zum Vorschein kommen zu lassen! Mein hehrer Kampf gegen den sinistren Spinne-Feind hatte letzten Endes eins offengelegt: das Böse in mir.
Ich musste eingestehen, und das ist das, was ich eingangs bereits bemerkte: Ich bin gar nicht so und war auch nie so gewesen. Natürlich hatte ich mein ganzes Leben dem Kampf für das Gute gewidmet. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Ein Konzept für das Gute ist nur möglich, wenn gleichzeitig der Begriff des Bösen geschaffen wird. Wer aber über beides verfügt, muss sich dauernd entscheiden. Für das eine oder andere. Oder für das eine um des anderen Willen.
Die Kreatur schwieg. Funkelte mich aus dunklen Knopfaugen an. In meinem Hirn brodelte es. „Okay“, sagte ich. „Keine Ahnung, wie du es angestellt hast. Aber es fühlt sich alles gerade ziemlich scheiße an.“
„Ja, Kacke“, entgegnete Dieter Spidermann. „Wieder was gut gemacht!“ Er verdrehte die riesigen Augen, was bedrohlich und zugleich total dämlich wirkte. „Ich bin echt der totale Loser.“
Als ich nicht gleich raffte, was er meinte, ergänzte er traurig: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“ Ein fetter Tropfen löste sich aus seinem linken Auge und platschte auf den Boden der Umkleide. Dem lebenslänglich antrainierten Gutmenschen in mir wurde ganz schwummrig.
„Okay, Dieter“, sagte ich. „Wenn ich die Knoten aus deinen Beinen wieder löse – Was gibst du mir erstens dafür? Und wer garantiert mir zweitens, dass du dich wieder in deine Latex-Pelle begibst und unauffällig verhältst?“
Blitzte da etwas in seinen Augen auf?
„Rettest du gerade wieder die Menschheit, dein Seelenheil oder geht es um deinen persönlichen Vorteil?“
„Ich dachte, es ginge um dich“, konterte ich. Wusste, dass es nicht darum ging. Wusste, dass er wusste, dass ich es wusste.
Wir kommen klar. Nein. Wir sind ein gutes Team. Ein Dreamteam. Dieter Starker und Mark Kant. Die Namen sprechen für sich. Body and Brain. The Good, the Bad and the Ugly. Die Kollegen sagen gelegentlich, wir spinnen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ob zum Guten oder zum Bösen: Wir retten. Die Welt. Uns. Vielleicht auch dich.
Bildquelle: (c) DA